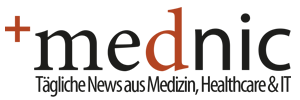Im Projekt Teleschlafmedizin wollen Forscher eine Telemonitoring-Plattform für Patienten mit Schlafstörungen und Atemaussetzern im Schlaf entwickeln, die insbesondere für die außerklinische Betreuung geeignet ist. Nun wird das Vorhaben mit rund 1 Million Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
Das Projekt Teleschlafmedizin führen das Institut für Biomedizinische Technik an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik und die Klinik und Poliklinik für Neurologie der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden gemeinsam mit der ResMed GmbH & Co. KG durch. Sie wollen die Entwicklung der Telemonitoring-Plattform für Schlafmedizin vorantreiben. Aufbauend auf bereits vorhandenen Techniken sowie Mess- und Analysesätzen soll darüber der Krankheitsverlauf von Patienten mit Schlafstörungen und Atemaussetzern erfolgen, um deren Therapie zu optimieren. Nicht nur der Arzt, sondern auch der Patient soll eine Rückmeldung durch das System erhalten.
„Wir wollen ein praxistaugliches System entwickeln: Ein sinnvolles Hilfsmittel sowohl für Ärzte als auch für Patienten. Uns ist es besonders wichtig, dass das neue System den diagnostischen Bedürfnissen der Ärzte entspricht. Deshalb definieren wir gemeinsam mit den Medizinern Anforderungen an das System und entwickeln es dementsprechend“, so der Projektkoordinator Prof. Hagen Malberg, Direktor des Institutes für Biomedizinische Technik der TU Dresden.
Kontaktlose Schlafüberwachung
Anders als bei bisherigen Schlafüberwachung soll es bei dem neuen Teleschlafmedizin-System keine Verkabelung geben. Dazu wollen die Forscher eine kontaktlose Messtechnik für schlafmedizinische Anwendungen entwickeln. Über sie sollen zukünftig alle wichtigen Parameter des Patienten erfasst werden, die für die Diagnose der Schlafstörung relevant sind: von Atemaussetzern bis hin zu auffälligen Gehirnaktivitäten. Die Wissenschaftler sind überzeugt: Ohne Kabel ähnelt die Untersuchungssituation mehr der häuslichen Umgebung und der Patient fühlt sich wohler. Dadurch soll die Qualität des Schlafs und damit auch die Qualität der erhobenen Patienten-Daten steigen.
Gerätevernetzung
Häufig müssen Patienten mit Schlafstörungen zur auch zu Hause Spezialgeräte einsetzen, die den Schlaf überwachen. So gibt es bei der Maskentherapie bereits heute Telemedizingeräte, die die Nutzungsdaten in eine Cloud senden. Gleiches gilt auch für viele andere Geräte. Miteinander vernetzt sind sie allerdings noch nicht. Der Arzt muss deshalb mit hohem Aufwand auf verschiedenste Systeme zugreifen und die Patientendaten einzeln für jedes Gerät auswerten. Das soll sich mit der neuen telemedizinischen Infrastruktur ändern, die die Wissenschaftler entwickeln wollen.
Smartes System
Dank intelligenter Vernetzung sollen alle relevanten Daten dem Arzt zukünftig gebündelt vorliegen. Intelligente Algorithmen sollen zudem eine automatisierte Aufbereitung der Daten ermöglichen. Dadurch soll sich die sonst in der Telemedizin übliche ärztliche Kontrolle der Daten erübrigen: Das System meldet sich automatisch, wenn eine ärztliche Entscheidung erforderlich ist.
Mit dem System soll zudem eine schnelle und direkte Kontaktaufnahme zwischen Arzt und Patient realisiert werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, dass die Gerätehersteller selbst die Patienten über die richtige Bedienung der Geräte im häuslichen Umfeld anleiten. Davon erhoffen sich die Wissenschaftler eine steigende Behandlungsqualität, da vor allem im häuslichen Umfeld kann damit besser diagnostiziert und optimaler therapiert werden kann. Auch über das Projekt Teleschlafmedizin haben die Forscher Pläne: Sie wollen grundlegende Probleme Telemedizin adressieren und so eine Basis schaffen, um die Lösungen auf andere Bereiche der Telemedizin zu übertragen.